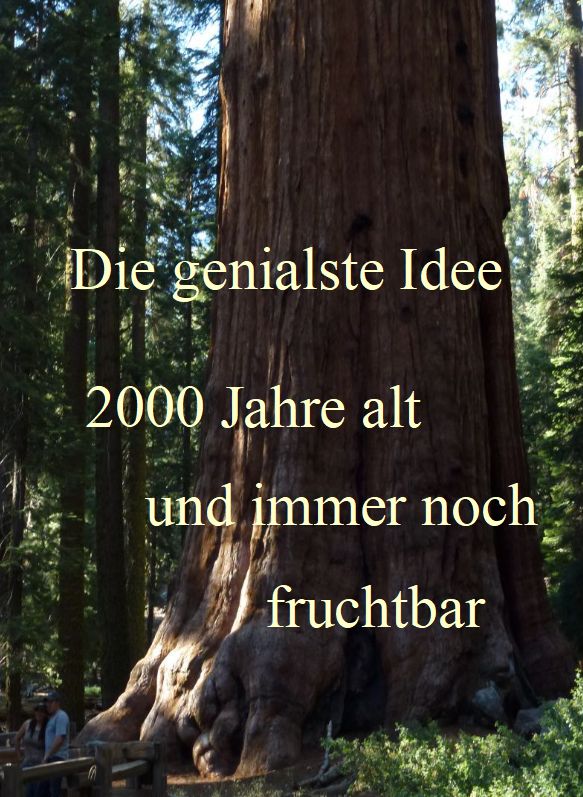Trotz etlicher Ungereimtheiten in den Briefen und Evangelien
Viermal wird im Neuen Testament Jesu Leben erzählt: dreimal ähnlich und einmal, im Johannes-Evangelium anders. Wie kann das sein, fragt die historisch-kritische Forschung und versucht die Entstehung zu erklären: Zuerst wurde das Markus-Evangelium geschrieben, aber wegen seines seltsamen Schlusssatzes Kap.16,8 "Und sie (die Frauen) sagten niemandem etwas (von der Auferstehung Jesu), denn sie fürchteten sich." hätten unabhängig voneinander Lukas und Matthäus das Evangelium noch einmal neu geschrieben und mit weiteren Erzählungen erweitert. Später hätte dann jemand an das Markus-Evangelium noch eine Zusammenfassung von Auferstehungserzählungen der anderen drei Evangelien, also auch des Johannes-Evangeliums angehängt: den unechten Markus-Schluss. Das Johannes-Evangelium sei unabhängig von den anderen drei vermutlich als letztes in Auseinandersetzung mit der damals einflussreichen Weltanschauung der Gnosis geschrieben worden.
Trotz vieler Unstimmigkeiten, die eine genaue historische Rekonstruktion der Ereignisse zum Beispiel in ihrem zeitlichen Ablauf unmöglich machen, wurden alle vier Evangelien nebeneinander gestellt und zählten schon ab Mitte des 2. Jahrhunderts zum neutestamentlichen Kanon.
Unstimmigkeiten gibt es auch in der Apostelgeschichte im Vergleich zum Lukas-Evangelium im Blick auf die Himmelfahrtsgeschichte, obwohl sie anerkanntermaßen von einem Verfasser stammen, ebenso wenn man die drei Schilderungen der Bekehrung des Paulus in der Apostelgeschichte miteinander vergleicht und dies dann noch einmal mit dem, was er selbst darüber in seinen Briefen schreibt.
Daneben gibt es noch viele weitere Details in den Evangelien und übrigen Schriften des Neuen Testaments, die die historisch-kritische Erforschung ihrer Entstehung veranlasst haben.
Kriterium war in der Antike für die Anerkennung als heilige Schrift, dass die einzelne Schrift von einem Apostel, Apostelbegleiter oder Schüler stammte und allgemein in der Kirche anerkannt war. Für die beim Konzil beteiligten Bischöfe und Gelehrten war es dagegen nicht wichtig, ob die Schriften widerspruchsfrei waren, was das in ihnen Berichtete betraf. Wir heute hätten das sicher nicht durchgehen lassen und hätten genau wissen wollen, was wann und wo jeweils geschehen oder geredet worden war.
Heute wird ein solcher Umgang mit Literatur wie damals bei den ersten Konzilien parataktisch / Parataxe genannt. Man findet ihn in vielen alten Kulturen, aber auch bei heutigen Schriftstellern.
Davon zu unterscheiden ist hypotaktisches Denken und Schreiben /Hypotaxe, durch das unser Denken in unserer von den antiken griechischen Philosophen stark beeinflussten Kultur geprägt ist.
Dazu mehr bei Karen Gloy: Denkformen und ihre kulturkonstitutive Rolle, Paderborn 2016
Das eigentliche Problem besteht also darin, dass wir nicht davon ausgehen, dass unsere Art zu denken, zu reden und zu schreiben kulturell geprägt ist und nicht notwendiger Weise so sein muss, sondern es auch andere Arten gibt, die genauso wie unsere Art ein Recht haben und bestimmten Zielen dienen.