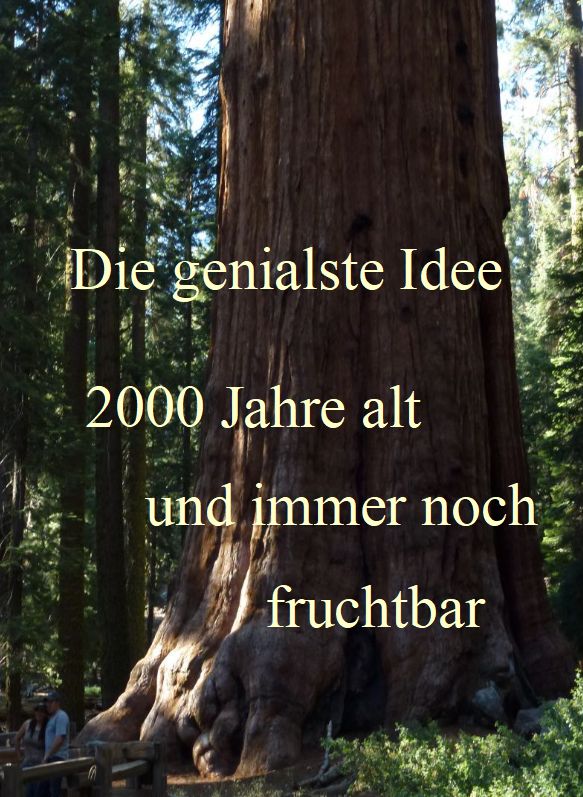-
In den letzten rund 2000 Jahren seit Abfassung der im Neuen Testament überlieferten Schriften hat sich unsere Art zu denken und die Welt zu verstehen bekanntlich sehr verändert.
Wir setzen oft ein Zeitverständnis voraus, dass es damals noch nicht gab: Die Zeit als eine gerade Linie, die aus der Vergangenheit kommt und über die Gegenwart in die Zukunft reicht. Wir bilden sie mit einem Zahlenstrahl / einem Zeitpfeil ab.
Wir berücksichtigen nicht, dass man weithin die Zeit zyklisch betrachtet, entsprechend dem Jahresverlauf von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, oder als Lebenszyklus von der Zeugung über die Geburt, das Wachstum, Elternschaft, Altwerden, Sterben.
In der Geschichte von Völkern sprach man von Ären, den Herrschaftszeiten bestimmter Könige oder Dynastien.
So werden in biblischen Schriften zwar bestimmte Ereignisse nach dem Herrschaftsjahr des Königs datiert, da diese Herrschaftsjahre aber irgendwann im Laufe eines Jahres mal begonnen hatten und dann so gezählt wurden, werden zum Vergleich noch ein oder zwei weitere gleichzeitig Herrschende aus Nachbarländern genannt. Das ist für uns heutige immer noch ungenau. Aber es gab einfach die fortlaufende Zählung von Jahren noch nicht.
Erst im Mittelalter wurde die fortlaufende Zählung der Jahre allgemein üblich.
Zwar hatte der Mönch Dionysius Exiguus schon 525 die Jahre ab Jesu Geburt gezählt und sie entsprechend bezeichnet. Doch war dies im Rahmen seiner Aufgabe, die Ostertermine für die nächsten Jahrzehnte zu berechnen, passiert und lange Zeit nur Spezialisten bekannt.
Erst 1474 bewirkte der Kölner Werner Rolevinck mit seinem Buch „Fasciculus Temporum“ ("Zeitbündel"), das von Erschaffung der Welt bis zur Gegenwart Ereignisse behandelte und indem er die retrospektive Datierung „v. Chr.“verwendete, eine Veränderung in unserem Zeitverständnis in Richtung zu unserem heutigen. Sein Werk hatte eine Auflage von 100.000 Exemplaren und sorgte so für eine Verbreitung dieser Zeitdatierung. Doch setzte sich dies in Europa erst im 17. Jahrhundert vollständig durch.
Der heutige Jüdische Kalender beginnt zwar mit dem Jahr 3761 v. Chr. und zählt unser Jahr 2025 als das Jahr 5788 (seit der Welterschaffung), ist selbst auch erst seit dem Mittelalter bezeugt.
Auch von christlicher Seite gab es damals Versuche, das Datum der Welterschaffung nach Jahresangaben der Bibel zu berechnen, so durch James Ussher (1581-1656), der den 23. Oktober 4004 v. Chr. (Julianischer Kalender) dafür ansah und durch seine Weltgeschichte bekannt machte.
Im Wikipedia-Artikel zur "Zeit" werden drei Möglichkeiten, Zeit zu verstehen genannt:
"Die vergleichende Kulturwissenschaft und die philosophische Reflexion darauf führen immer mehr zu der Einsicht, dass es die Zeit als anthropologische Konstante, die allen Menschen gleicherweise zukommt, überhaupt nicht gibt. Vielmehr existieren kulturspezifische Zeitauffassungen mit diversen Strukturen, wie:
- die zyklische der Vorsokratiker und der Naturethnien, die sich in der Annahme von der ewigen Wiederkehr des Gleichen dokumentiert,
- die eschatologische, die einen Anfang hat und auf ein Endziel gerichtet ist und auch die vormoderne Geschichtsauffassung bestimmt,- die gradlinig-kontinuierliche, aus der Vergangenheit kommende und über die Gegenwart in die Zukunft gehende, die in der traditionellen Physik zugrunde gelegt wird und die wir heute zumeist als universell unterstellen, die aber ein westliches Kulturprodukt ist."
Im Neuen Testament wird die eschatologische Zeitauffassung vorausgesetzt. Die Zeit hatte ihren Anfang, als Gott unsere Welt erschuf, und sie wird ein Ende haben, dann wenn Jesus in unsere Welt zum Gericht über uns Menschen zurückkehren wird, zum Jüngsten Gericht, das so genannt wird, weil es danach keines mehr geben wird. Es ist die höchste Instanz der Rechtsprechung.
Da man noch nicht, wie wir heute, die Zeit streng linear verstand, konnte man die vier Evangelien nebeneinander veröffentlichen, auch wenn sie im Blick auf die Zeit unterschiedliche Angaben über das Leben Jesu machen, was wir Heutigen aber nicht durchgehen lassen wollen und uns schon Jahrzehnte lang streiten, wie genau seine Wanderung durch Galiläa, Samaria und Judäa damals abgelaufen ist, wann er wo war, in welchem Jahr genau er geboren wurde usw. Mehr dazu hier bei Wikipedia.
Stattdessen benutzten die Menschen damals Bemerkungen zur Zeit dazu, um etwas anderes auszudrücken als eine Lokalisierung auf dem Zeitstrahl. Wenn die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 damit beginnt, dass "ein Gebot vom Kaiser August ausging.. und dies geschah, als Quirinius Stadthalter in Syrien" war, so wird damit literarisch ein riesen Bogen geschlagen vom Kaiser in Rom zu dem neugeborenen Kind, für das kein Platz in der Herberge war und das deshalb in einem Stall zur Welt kam und in eine Krippe gelegt wurde." - Dieser riesige Bogen ist eine Provokation! - Keine Zeitangabe.
Ganz anders und doch ähnlich geht Matthäus vor, nur dass er den Bogen nicht ganz so weit schlägt, nur ca. 53 km, nämlich vom Palast des Königs Herodes in Jerusalem zu einem Ehepaar seiner Untertanen nach Bethlehem, denen gerade ein Sohn geboren wurde. Vorher hatte er literarisch aber schon einen anderen Bogen geschlagen, von Magiern/Astrologen aus dem Morgenland, also dem Osten, dem Zweistromland zu einem neuen Stern, dann quer durch die Wüste bis nach Jerusalem. Und dann schlägt Matthäus nochmal einen weiten Bogen von Bethlehem bis nach Ägypten.
Beide Evangelisten sind sich inhaltlich einig: Bei dieser Geburt ging es um etwas, womit sich Herrschende mal zu beschäftigen haben würden. Die lokalen und zeitlichen Angaben die sie benutzten, um dies ihren Lesern zu verdeutlichen, sind völlig verschieden. Aber das störte damals niemanden. Denn es galt die "gute Nachricht" /das Evangelium für Menschen aller Völker zu verstehen und weiter zu sagen, nicht die Biographie eines Menschen.
*******
Lukas hat nicht nur ein Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Das zeigt sich nicht nur an seinen einleitenden Worten, sondern auch bei einer Analyse seiner Sprache und Schreibart. Darin sind sich alle Forscher einig. Ungewissheit besteht allerdings darin, ob er zuerst die Apostelgeschichte und dann erst das Evangelium geschrieben hat oder umgekehrt. Denn die Schilderung des Abschieds von seinen Schülern, den Jüngern und seiner Himmelfahrt stimmt lokal und in den Zeitangaben nicht überein. Hat er also zuerst die Apostelgeschichte geschrieben, dann das Evangelium und inzwischen vergessen, was er zu Beginn der Apostelgeschichte geschrieben hat? - So fragt ein zeitlich linear denkender heutiger Leser, der dies bemerkt.
Lukas beschreibt zwar das Leben Jesu im Evangelium und in der Apostelgeschichte die Ausbreitung des christlichen Glaubens bis dahin, dass Paulus in Rom ankommt, - für uns Heutige ein klarer roter zeitlicher Faden jeweils - doch zeigt die eben beschriebene Beschreibung der Himmelfahrt Jesu, dass er nicht zeitlich linear gedacht hat, sondern dass die Botschaft, die er vermitteln wollte, sein Schreiben bestimmte. Von Jerusalem ausgehend soll von Jesu Schülern Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden (Lukas 24,47).
*******
Besonders verleitet uns Heutige die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt, dazu, sie zeitlich zu verstehen und verleitet uns zu Spekulationen über das Weltende und den Zeitpunkt des Wiederkommens Jesu. Sie endet mit den Worten: "Es spricht, der solches bezeugt: Ja, ich komme bald." und "Amen" - das heißt: Das ist wahr.
Es folgt der Wunsch "Ja, komm, Herr Jesus" und das Segenswunsch: "Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!"
Es handelt sich um ein Zwiegespräch ohne konkrete Zeitangabe, um den Wunsch, dass es bald sein möge.
Da dies die letzten Worte der Bibel sind und sie im Alten Testament mit den Worten beginnt: "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde" entsteht leicht das Missverständnis als handle es sich bei der Bibel um die Beschreibung der Welt von Anfang bis zu ihrem Ende - zeitlich linear gedacht, aber auch nach dem eschatologischen Zeitverständnis. Nicht beachtet wird dabei,
-
dass schon im 2. Kapitel des 1. Buch Mose eine zweite, ganz andere Schöpfungserzählung steht
-
dass zu Schöpfungsgeschichten passende Weltvernichtungs- /Weltenderzählungen gehören. Nicht erst wir Heutigen wissen, dass wir durch unser Handeln und unsere Art zu Wirtschaften, um unter Umständen Kriege mit Atombomben zu führen nicht nur unsere Zukunft, sondern die der gesamten Menschheit und allem Lebendigen bedrohen. Von der Möglichkeit dieses Endes erzählt zum Beispiel die Singflutgeschichte in 1. Mose 6-9. Allerdings erzählt sie diese auch in der damaligen Umwelt bekannte Weltuntergangsgeschichte als eine Rettungsgeschichte: Die Rettung einer Familie von 8 Menschen und aller Tiere. Das Besondere dieser sich seltsam und langatmig zu lesenden Erzählung ist, dass hier sich zwei Erzähler ständig ins Wort fallen. Der eine spricht von jeweils 2 Tieren, die mit auf die Arche genommen werden, der zweite von je 2 von den unreinen Tieren und je 7 von den reinen Tieren. Völlig unterschiedlich sind auch die Zeitangaben über die Dauer der Sintflut und wann die Arche wieder verlassen werden konnte. - Auch hier zeigt sich wieder, dass zeitliche Angaben eine Botschaft enthielten, aber nichts über die Dauer von tatsächlich Geschehenem aussagen.
-
Auch das Johannesevangelium beginnt mit den Worten "Im Anfang " - fährt dann aber ganz anders fort als im 1. Buch Mose 1. Dieses Wort kann zwar zeitlich verstanden werden, meint aber viel mehr: Das was alles miteinander eint, in allem ist. "En "Archē (altgriechisch ἀρχή archḗ ‚Anfang, Prinzip, Ursprung‘, Plural ἀρχαί archaí, lateinisch principium)" ist ein zentrales Wort in der griechischen Philosophie, ebenso Logos , von dem es in Johannes 1,1 heißt, dass er im Anfang war. Wer dies heute zeitlich linear versteht, versteht nicht die Fülle von Weisheit, die diese Worte beinhalten.
-